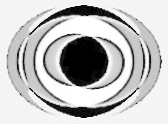Helko Reschitzki, Moabit
Vor einer Woche bin ich bei meinem mecklenburger Dorfbesuch auf dem Weg zu den Wilderdbeeren aus Versehen auf eine Schnecke getreten. Ihr Gehäuse war angeknackst, der Körper mit ungesund aussehendem Schleim und Schaumbläschen bedeckt. Das Tier wirkte mehr tot als lebendig und bewegte sich, wenn überhaupt, nur noch minimal. Wir überlegten, was zu tun sei. Ich war bereits auf dem Weg zum Schuppen, um den Spaten zu holen und dem Ganzen ein schnelles Ende zu setzen. Da erinnerte sich meine Gastgeberin, dass Schnecken über immense Selbstheilungskräfte verfügen – und dass man diese von außen unterstützen kann. Das schien uns einen Versuch wert, auch wenn wir dabei hin- und hergerissen waren, weil wir das Leid nicht unnötig verlängern wollten – einfach so töten aber auch nicht. Also bereiteten wir in einer Gartenbox schnell ein kleines Krankenbett aus Gras, feuchter Erde, Gurkenscheiben, Eierschalen und Salat: Flüssigkeits-, Energie- und Kalziumlieferanten.

Fünf Tage danach erreichte mich die Nachricht, dass der Riss im Gehäuse verschlossen und die Schnecke wieder munter sei, so dass sie nun aus dem Lazarett entlassen werden konnte. Mich erstaunt, dass die Rekonvaleszenz so gut verlief, und auch, wie schnell das ging – in dem Fall stand die Heilung in umgekehrtem Verhältnis zur sprichwörtlichen Schneckengeschwindigkeit. Was für eine Freude!

Als Gruß in die Ferne legte ich der Genesenen gerade das Lied „Die Schnecke“ von Hildegard Knef auf – die wußte auch, wie man sich immer wieder an dünnsten Fäden ins Leben zurückzieht …