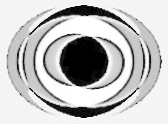Frank Schott, Leipzig
Mein Innenleben fühlt sich an, als würde man kopfüber an einer Brücke schrauben, während man auf einem klapprigen Gestell steht, das auf einem Floß steht, das auf einem Fluss schwimmt.
Nach dem Montagsblues, kamen der Dienstags-, der Mittwochs- und der Donnerstagsblues. Während aus einem grauen Himmel Regen rieselt und Blätter von den Bäumen tröpfeln, sehe ich zwei Männer auf einem Gerüst auf einem Floß auf einem Fluss, die an einer Brücke schrauben.
Genau das meine ich. Manchmal muss man nur hingucken.

Das Joggen fällt mir unendlich schwer. Liegt das noch an meiner Blutspende? An der Grauheit der Oktoberwelt? Am Blues? Nach einem Kilometer möchte ich am liebsten aufgeben.
Doch was ist eigentlich die korrekte Strategie gegen die eigene Schwäche – zu pausieren, um den Körper zu schützen? Oder sich durchzubeißen, um aus dem Tal herauszukommen? Wie immer ein einerseits, andererseits. Ich muss eine Entscheidung treffen.
Meine schmerzenden Füße setzen einen Schritt nach dem anderen. Meine Augen sehen die beiden Männer an der Brücke. Mein Kopf zählt die Schritte. Ich laufe weiter, während ich mir sage, dass ich mich mit jedem querenden Pfad kurzerhand auf den Rückweg machen kann. Doch nach etwa 25 Minuten habe ich die Melancholie und Mattheit überwunden. Ich vollende meine übliche Strecke, die wegen der matschbedingten Umwege ein paar hundert Meter länger ist als sonst – in einer Zeit, die mir gleichgültig ist.

Der Mittwoch war der bisher einzige relativ sonnige Tag in dieser Woche. Auch der Wind war vergleichsweise still. Da ich diesmal nicht laufen wollte, entschied ich mich fürs Rad und eine Umrundung des Kulkwitzer Sees. Das ist ein gefluteter Braunkohletagebau am Stadtrand. Er dient seit 1973 als Naherholungsgebiet, ist also deutlich etablierter als die erst in den 2000er und 2010er Jahren geschaffenen Gewässer im renaturierten Bergbaurevier Südraum Leipzig. Zuletzt war ich in den Neunzigern als Student dort.

Die ersten 10 Kilometer fuhr ich wie berauscht durch die Stadtteile Schleußig, Plagwitz, Grünau und Lausen. Fußgänger, Radfahrer, der schwarze Asphalt – alles flog nur so an mir vorbei. Der See war herbstlich bewaldet, der Rundweg bis auf einige Spaziergänger mit und ohne Hund nahezu leer.
Zurück in der Stadt beginnt wieder das Grübeln. Eben noch befreit „I did it my way“ gesungen, dann „Bedecke Deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst“ geflucht. Schwäche in den Beinen, Schwäche im Kopf.
Fragen ohne Antworten, triste Herbstsonne, graue Blätter.

Unsere Blogautorengemeinde entdeckt ja gerade die russischen bzw. sowjetischen Schriftsteller neu. Das erinnerte mich an meine alte, Ende der Achtziger antiquarisch gekaufte Aufbau-Ausgabe von Bulgakows „Der Meister und Margarita“. Ich habe sie entstaubt und lese nun jeden Tag zwei bis drei Kapitel. Heute, fast vierzig Jahre nach der Wende, nehme ich nicht so sehr die grotesken, satirischen und religiösen Inhalte wahr, sondern vor allem eine bitter-böse Abrechnung mit dem Sozialismus sowjetischer Prägung.
Mich überkommen Erinnerungen an die DDR-Zeit: Das Schachern um die knappen Wohnungen, das heimliche Horten von Edelmetall und Devisen, das verlogene, nur um sich selbst rotierende Denken und Handeln der Kulturschaffenden, die Autoritäten, Behörden und Ämter mit ihren irrationalen Regeln und willkürlichen Verboten. Manch einer träumt ja auch heute wieder vom „endlich richtigen Sozialismus“ – mit Planwirtschaft, Verstaatlichungen, ideologischer Gleichschaltung und Repression. Die meisten, die sich nach so etwas sehnen, werden den realen Sozialismus wohl nie selbst erlebt haben. Wie soll man bei solchen Gedanken nicht den Blues kriegen?

Am Dienstagabend hatte ich ein Beben in der Brust – ausgelöst von den heftigen Bässen in der Leipziger Arena. Der deutsche Musiker Hans Zimmer, für mich einer der innovativsten Filmkomponisten unserer Zeit, brachte den Sound seiner Lieblingsstücke mit einem ausgewählten Ensemble auf die Bühne. Das muss wahre Freiheit sein: Du kannst die Melodien, die oft nur als Versatzstücke und Hintergrundstimmung durch einen Film rauschen, so kombinieren und instrumentieren, wie du es willst. Du brauchst ein Schlagzeug? Warum nicht vier Schlagzeuger gleichzeitig auftreten lassen? Das Ergebnis ist akustisch und optisch überwältigend.

Im Konzert wird mir erstmalig bewusst, wie wichtig bei Hans Zimmer der Einsatz der menschlichen Stimme für das Gesamtbild der Musik ist – sowohl Solo als auch im Chor. Und was für Stimmen er mit nach Leipzig brachte! Der Südafrikaner Lebo M, die Originalstimme aus „Lion King (König der Löwen)“ kam auf die Bühne. Die australische Sängerin Lisa Gerrard sang im „Gladiator“-Medley, wobei das Wort „Medley“ nicht den Kern trifft – vielmehr waren es eigenständige Arrangements, die Zimmer speziell für die aktuelle Tour geschrieben hat. Natürlich ist hier nichts improvisiert – das wäre bei einem so großen Musikerkreis gar nicht möglich, und dafür ist Zimmer auch zu perfektionistisch. Doch er spielt mit seinen eigenen Melodien und Themen und schafft so ein eigenständiges Werk, das es in der Form nur live zu erleben gibt.
Drei Stunden spielen Hans Zimmer und sein großartiges Ensemble, dann geht es zurück in die Leipziger Nacht. Vor der Arena bietet, elektronisch verstärkt, ein schlechter Straßenmusikant dröhnend Coverversionen von Pophits dar.
Zurück in der Realität.
Und da ist er wieder – mein Blues.