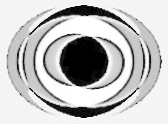Frank Schott, Leipzig
Wie der Blickwinkel täuschen kann: Gott und die Kirche sind nicht „IM ANGEBOT“ – auch wenn aktuell viele kirchliche Organisationen und Würdenträger ihre christlichen Fundamente für kurze Momente zeitgeistlicher Aufmerksamkeit zu verramschen scheinen.

Seit ich Rushdis „Satanische Verse“ lese, denke ich immer wieder über Gott und den Glauben nach. Gibt es ein höheres Gut als die irdische Befriedigung? Lohnt es sich, danach zu streben? Und was ist, wenn man fragt und niemand antwortet? Der Einbandtext des Buches spricht von „Glaubensverlust“ und einer „entgöttlichten Welt“. Ich bin mir da nicht so sicher – auf mich wirkt dieser Roman eher wie ein verzweifeltes Hoffen auf, ein künstlerisches Ringen um eine Kraft jenseits der stofflichen Dinge.

Gerade im Advent wird das Göttliche profan. Das Licht im Dunkeln verspricht keinen Halt und keine Wiedergeburt, sondern leitet nur zum nächsten Verkaufsstand für Nadelbäume. Trotzdem entfaltet der Lichterbaum bei mir eine Wirkung – möglicherweise aufgrund von Kindheitserinnerungen, durch meine Sozialisation?
Im Dunkeln torkelt mir ein betrunkenes Paar entgegen, beide mit einer Bierflasche in der Hand. Er klagt ihr lallend sein Leid: „Alle spucken auf mich runter.“ Sie, mit etwas gefestigterer Stimme: „Nein, Schatz, niemand spuckt auf dich!“ – Er, weinerlich: „Doch, alle spucken auf mich!“ – Sie, rationaler: „Wenn sie auf dich spucken, dann spucken sie auch auf mich …“ Für einen Sekundenbruchteil überlege ich, den Mann kurz in die Arme zu schließen und zu trösten. Dann sind sie an mir vorbei – und vorbei ist auch der kurze, etwas selbstmörderische Impuls einen fremden Betrunkenen zu drücken, der gerade mit seiner Angebeteten streitet. Ist das dieses komische Weihnachtsgefühl der Nächstenliebe, von dem alle reden?
Trostlos ist auch der offizielle Weihnachtsbaum in der thüringischen Kleinstadt meiner Schwiegereltern. Nackt und bar jeden Schmucks erscheint er mir als Sinnbild für Menschenherzen. Unter dem Baum stehen Figuren aus dem Märchenwald. Und ein Weihnachtsmann – was es nicht besser macht.
Wir sind in die Kleinstadt gefahren, um die Uroma zu besuchen. Mit 97 Jahren war sie so gebrechlich geworden, dass sie in ihrer eigenen Wohnung immer öfter stürzte. Den Großeltern, die selbst schon auf die 80 zugehen und sich ihrer körperlichen Schwächen jeden Tag bewusster werden, fiel es zunehmend schwerer, auch noch die Urgroßmutter zu versorgen.
Ich bin das erste Mal in einem Pflegeheim. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Natürlich weiß ich um aufopferungsvolle Pfleger, um Aktivitäten in der Gruppe, um Geselligkeit mit anderen Menschen, aber diese Mischung aus Klinik und Kindergarten deprimiert mich. Die Zimmer mit ihren Betten auf Rädern, den wenigen privaten Gegenständen und rutschfesten Fußböden erinnern stark an ein Krankenhaus. Die Alten, die in Rollstühlen zu den gemeinsamen Mahlzeiten an die Tische geschoben werden und dort, umgeben von Pflegern, sitzen, erinnern mich an meine Kindergartenzeit – alle sind brav, alle schlürfen vernehmlich, alle essen weisungsgemäß auf. Kommt es nur mir so vor oder sehe ich Unglück in den Augen der Uroma? Aber wie ließe sich ihr Leben anders organisieren?

Etwas Trost spendet der Teich mit seiner Einfamilienhaussiedlung für Enten. Trotz Vogelgrippe sitzen die Weiblein und Erpel im Wasser, schnattern, gründeln oder lassen die Beine baumeln. Ich habe den Eindruck, als wäre ihre Zahl geringer als beim letzten Mal als ich hier war. Aber vielleicht hocken die anderen auch nur bei Kerze und Gebäck in ihren Hütten und stimmen sich auf den Advent ein? Eine schöne Vorstellung.

Zurück in Leipzig laufe ich wieder. Die Spannkraft aus der lichten Jahreszeit fehlt noch immer, aber ich spule mein Programm ab. Aus den 8,5 Kilometern sind jetzt schlammbedingte 9 geworden. Wenn meine üblichen Waldwege gefroren sind, ist der Untergrund nur wenig elastischer als ein Bürgersteig. Ich jogge nicht gerne auf befestigten Wegen wie Asphalt oder Stein. Aber was muss, das muss. Es wird Zeit, dass Frühling wird.
Das sagt sich auch der Schwarze Nachtschatten. Vor knapp zwei Wochen noch in spätherbstlicher Blüte stehend, hat ihm der Frost ein jähes Ende bereitet. Kraftlos hängen die Blätter, verschwunden sind die weißen, sternförmigen Blüten.

Stattdessen recken sich im zivilisierten Teil des Parks Hügelgräber aus Laub in die Höhe. Die ganze Woche über wird den Blättern der Marsch geblasen. Kolonnen von Stadtbediensteten im leuchtenden Orange pusten wie im Wettkampf über die Wiesen und Wege. Die Verlierer der internen Laubbläsermeisterschaft müssen dann alles zu Haufen zusammenrechen. Kleine Pritschenwagen kurven herum, reißen die gerade erst befestigten, doch jetzt feuchtrutschigen Wege auf und hinterlassen tiefe Spurrinnen. Nur am Sonntag ist Ruh. Der Vormittag gehört den Kirchenglocken.
Es wird Zeit, dass Frühling wird.