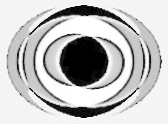Helko Reschitzki, Moabit

Eine vergleichsweise ruhige Woche, in der das Flügelschlagen eines vorbeifliegenden Schwanes manchmal das lauteste Geräusch des Tages ist, sein Anblick die größte Action. Ein unspektakulärer Alltag wird gemeinhin unterschätzt. Nach einem strauchvollen Monat neigt sich die Brombeersaison ihrem Ende zu – man muss schon sehr genau hinschauen, um noch reife Früchte zu entdecken. Auf deren Schwarzviolett folgt das Orangerot der Hagebutten. Eicheln ploppen auf den regenfeuchten Grunewaldboden. Samstagnacht sinkt die Lufttemperatur auf 10 Grad. Es geht langsam Richtung Herbst.

Nach gut fünf Wochen hat sich die durch den Starkregen in den Schlachtensee geschwämmte Muttererde so verteilt, dass der Grund nun wieder hell ist. So kann ich wie zuvor das schnelle Licht-und-Schatten-Spiel der Rotfedern in all seiner Schönheit bewundern.

Viele gute Buchtbankgespräche: Eine Literaturwissenschaftlerin, die mir erzählt, wie sie, ein renitentes Pfarrerskind, 1974 mit 18 Jahren die DDR verlässt. Erst im Westen konnte sie dann die Bücher aus der alten Heimat ertragen, später sogar wertschätzen. (Wir einigen uns auf Strittmatters „Der Wundertäter“ als großen DDR-Wurf.) Jegliche Nostalgie ist ihr, so wie mir, zuwider. Sie empfiehlt mir Christoph Heins neues Buch „Das Narrenschiff“ – bin gespannt. Dann ein Mann, der im Technikbereich arbeitet. Um ihn herum wird gerade eine Abteilung nach der anderen von KI-Tools ersetzt. Wir reden darüber, wie das Thema hierzulande komplett verschlafen wurde – statt vorausschauend über smarte soziale Lösungen nachzudenken, floss die Energie in kollektive Verdrängung. Dann kommen auch wir auf DDR und BRD zu sprechen. Er stammt aus dem Westen, und hat für seine Cousins immer Musikkassetten in den Osten geschmuggelt – „in einem Anorak mit Spezialfächern, uns Kinder hat man ja nicht so genau gefilzt“. Er wuchs in einer armen Familie auf, konnte sich wenig leisten: „Im Osten waren die Läden ja von vornherein leer. Aber wenn du das alles vor der Nase hängen hast und dann nichts kaufen kannst, ist das auch ziemlich blöd.“ Wir stellen fest, dass wir beide tief in der Nacht aus dem Radio Musik aufgenommen haben, weil da nicht auf die Titel gequatscht wurde. So etwas verbindet.

Der Schlachtensee hat am Wochenende dieses Glitzern, das wirklich alle lächeln lässt. In der Bucht schwimmen jetzt regelmäßig zwei junge Stockenten umher, seit Samstag auch wieder ein Blässhuhn. Das sammelt Material für ein neues Nest. Davor sah ich tagelang gar keine Wasservögel – den einen Morgen dafür einen Aufblasflamingo. Den hatten drei Bolivianerinnen mitgebracht. Sie berichten, dass in ihrer Heimat eine Fabrik nach der anderen schließt, überhaupt vieles zusammenbricht, und fast jeder, der die Möglichkeit hat, das Land verlässt, um in Florida oder Europa sein Glück suchen. … und genau die bilden dann die Schattenkolonnen der Reinigungskräfte, Haus- und Hotelangestellten, Lagerarbeiter, Fahrer, Küchenhilfen, Gärtner oder Bauarbeiter, ohne die der westliche Schlaraffia-Lebensstil nicht aufrecht zu erhalten ist. Für uns stechen sie mit ihren Kollegen aus Nordafrika in Navarra Spargel, pflücken in Huelva Erdbeeren, lesen in La Rioja Trauben, verpacken in den Hallen von Almería Obst und Gemüse – die LKW-Flotten der Logistikfirmen übernehmen dann. Sie putzen nachts deutsche Büros und Supermärkte und am Tage die Krankenhäuser und Hintern unserer siechen Angehörigen. Da bringt so ein Flamingo etwas Farbe ins Leben. Ihren daheim gebliebenen Kindern schicken sie fröhliche Videos aufs Phone der Abuelita.

Das mit Abstand fieseste Geräusch der Woche: Der Aufprall des Mannes, der auf dem S-Bahnhof Nikolassee direkt neben mir von der beinebaumelhohen Streusandkiste abschmiert. Icke: „Brauchen Sie Hilfe?“ Er: „Ne, lass ma, geht schon.“ E rappelt sich hoch, nach zwanzig Sekunden ist er voller Blut – er tastet, ich kieke: Platzwunde am Kopf. Ich hole mein Erste-Hilfe-Päckchen aus dem Rucksack, biete ihm an, die Wunde zu desinfizieren. „Muss nich, das brennt immer so.“ Ich sprühe trotzdem etwas aufs Klopapier, dass ich ebenso dabeihabe, biete ihm das als Kompromiss an: „Das brennt dann nicht so doll.“ Damit ist er einverstanden – wir laden noch ein paar mal nach. Ich: „Wohnen Sie hier in der Nähe?“ Er, zeigend: „Ja, is nich weit.“ Ich biete an, ihn nach hause zu bringen. „Das schaff ich schon allein. Ist aber lieb von dir.“ Da er nicht lallt, nicht taumelt, nicht aussieht, als ob er krank oder druff ist oder schnell neuen Stoff braucht, wird ers wohl tatsächlich packen. Ich gebe ihm eine volle Packung Papiertaschentücher, worüber er sich freut. Meine Bahn fährt ein. Er: „Danke für alles und alles Gute.“ Ich: „Das wünsch ich auch – vor allem gute Besserung.“ Wir nicken uns zu, ich steige ein.