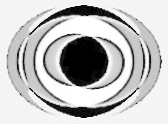Helko Reschitzki, Moabit

Am letzten Donnerstag dachte ich im ersten Moment, dass es auf der Rehwiese brennt – dann sehe ich, dass das was über den Rand der Senke zu mir hoch weht, Nebel ist. Ich gehe näher, stehe nun mittendrin, erlebe wie sich die Schwaden wie in Zeitlupe auflösend in alle Richtungen verflüchtigen. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages schneiden wie Lichtklingen durch die feuchte Luft und zeichnen scharf die Konturen von Gräsern und Blättern nach.

Das Wochenende verbrachte ich in Parchim, in meiner alten Heimat Mecklenburg. Am Samstag feierten wir im kleinen Familienkreis den 80. Geburtstag meiner Mutter, abends hatte ich ein Klassentreffen. Vierzig Jahre sind wir nun aus der Schule. Mein alter Banknachbar, der in Weißensee wohnt und mich mit dem Auto mitnahm, berichtet auf dem Rückweg, dass er den gesamten Abend Anekdoten aus der POS-Zeit ausgetauscht hätte. Und ich wiederum habe mich fast nur über unsrige heutigen Leben mit den Mitschülern unterhalten.

Am meisten hat mich die Klassenkameradin beeindruckt, deren Familie bei den Zeugen Jehovas war: Sie vollkommen unterdrückt in ihrer Kindheit und Jugend, durfte nichts, was irgendwie Spaß macht, dazu Außendruck von der Stasi. Sie konnte sich von alledem lösen, indem sie als junge Erwachsene in Berlin untertauchte und sich dort vier, fünf Jahre lang exzessiv in die innere Freiheit tanzte. Stabile Frau mit vernünftigen Ansichten – wenn du neben einer Diktatur mit ihrem zersetzenden Geheimdienst noch dem Gruppendruck einer Religionsgemeinschaft inklusive deiner Eltern standhalten musstest, weißt du, was wirklich zählt und lässt dich so schnell von keinem verarschen. Sie ist nun von Berlin in die Berge Sachsens gezogen.

Vor all den Feierlichkeiten gehe ich am frühen Morgen in Parchim im Wockersee schwimmen. Dichter Nebel auf all meinen Wegen. Der See in etwa so groß wie der Schlachtensee, das Wasser allerdings deutlich trüber; die Temperatur beträgt 9 Grad – das reicht für ein paar Minuten. Als ich mich abtrockne, kommt ein Mann zu mir, fragt, wie es war. Wir geraten ins Plaudern, stellen einander vor. Uwe, 74 Jahre, alter Metallformwerker, bis zur schweren Lungenentzündung im vergangenen Jahr einer der drei Winterschwimmer vor Ort. Nun geht er nur noch etwas im Flachen hin und her – „was natürlich kein Ersatz ist“. Zwei Angler passieren uns, grüßen. Uwe: „Am Morgen triffst du hier nur vernünftige Leute, die Idioten sieht man dann im Laufe des Tages in der Stadt.“ Vorige Woche musste er seinen Hund einschläfern lassen, hat damit noch zu kämpfen. Er erzählt, dass er an schleichender Blindheit leidet: „Wenn du mich also mal irgendwo siehst, sprich mich bitte an – ich würde dich nicht erkennen.“ Zur Verabschiedung schenkt er mir einen kleinen schrumpeligen Apfel und drückt meine Schulter. Ich kenne Mecklenburgerinnen, deren an sie gerichteten Heiratsanträge weitaus weniger herzlich waren.

Auf der Rückfahrt am Sonntag kommen mein alter Banknachbar und ich auch auf Fußballsammelbilder zu sprechen. Er hat die komplette Bundesligasaison 77/78 beisammen gehalten, und ich (Oh Wunder!) genau dafür ein leeres Album. Demnächst treffen wir uns zu einem Einklebeabend. Ich denke, wir werden dabei Springsteen hören, so wie 1984: „Well, we busted out of class / Had to get away from those fools / We learned more from a three-minute record, baby / Than we ever learned in school …“ Als wir auf der Stadtautobahn am Berliner Bären vorbeifahren, durchflutet mich mich wie immer riesige Freude – ja, meine Heimat ist nun eindeutig hier: Auf der Insel Moabit, inmitten dieser absurden Kleinstadt- und Dorfklumpung, die man gemeinhin Berlin nennt, und die zwar vieles von dem sein mag, was man sich so vorstellt, eines aber garantiert nicht ist: eine Großstadt.

Am Montag in der Schlachtenseebucht ein schönes Gespräch mit dem feinen älteren Herren, den ich dort öfter treffe, und der fragt, ob es in Ordnung wäre, wenn wir uns fortan Duzen – ist es. Manfred schwärmt mir so von seinen Neopren-Socken vor, dass ich mir nun auch welche kaufen werde. In den ersten beiden Läden waren leider gerade meine Größen ausverkauft – dann beim nächsten Mal.

Am Dienstag eine interessante neue Folge des Pandemia-Podcasts, in der es um die Bakterienart Chlamydien geht, die ein ernstes Gesundheitsproblem für Koalas darstellt. Ein Aspekt fesselt mich besonders: Koalajungtiere, von den Einheimischen „Joeys“ genannt, fressen mit etwa sechs Monaten den Kot ihrer Mutter, um deren Mikrobiom zu übertragen, das sich dann im Blinddarm ansiedelt, der bei Koalas sehr groß ist. Ein intaktes Mikrobiom ist für diese Tiere essentiell, da es die giftigen, schwer verdaulichen Eukalyptusblätter, ihre Hauptnahrung, zersetzt. Für mich spannend: Diese Technik wird zunehmend in der Humanmedizin angewendet, wobei gesunde Darmbakterien von einem Spender auf einen Patienten übertragen werden, um dessen gestörtes Mikrobiom wiederherzustellen. Der menschliche Blinddarm gilt heute auch nicht mehr wie früher als „überflüssiger Wurmfortsatz“ – es gibt sehr plausible Hinweise darauf, dass er als Rückzugsort für nützliche Darmbakterien dient. Nach Durchfallerkrankungen können sich die Mikroorganismen von dort aus erneut ansiedeln – eine Art biologisches Backup-System.