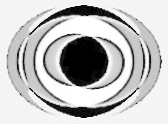Helko Reschitzki, Moabit

„Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen.“
… so zitiert Johannes Brahms in seinem Choral- und Orgelwerk „Ein deutsches Requiem“ die Apostel Jakobus der Ältere sowie Petrus (der sich wiederum auf Jesaja bezieht). Texte aus der Luther-Bibel, montiert und vortrefflich vertont zum Troste der Lebenden. Keine Liturgie, keine Totenmesse, weltlich, geerdet. Für mich ist es das schönste Requiem überhaupt – Friede beseelt mein Animistenherz. In der Woche vor Totensonntag sehe ich auf meinen Wegen immer wieder Menschen mit Gestecken, Tannengrün, Schleifen und Kerzen – vielleicht sind sie gerade auf dem Weg zu den Gräbern ihrer Liebsten. Ein schöner, stiller Brauch – und der einzige Feiertag hierzulande, der mich berührt. Am frühen Morgen betrugt die Außentemperatur zuletzt um die vier Grad minus. Das Nachtschwarz zieht sich immer weiter in den Tag hinein. Raureif lässt Pflanzen und Gräser scharfkantig erscheinen. Auf einigen S-Bahnsteigen und Brücken wird schon gestreut – nun knirscht es wieder beim Gehen.

Die Schlachtenseetemperatur sinkt rasant – am Samstag haben wir bereits die 6-Grad-Grenze erreicht. Justament als ich ins Wasser schreite, kommt ein mir unbekanntes Seniorenpaar in die Bucht. Der Mann ruft: „Tu es nicht – wir können über alles reden!“ Haha. Später gesellen sich kurz nacheinander zwei mal zwei Winterbader zu uns. Keiner schwimmt, und alle vier halten die Hände über dem Wasser – wirklich smart, da die Finger am schnellsten frieren (es sieht fast wie eine kultische Handlung aus). Jeder hat da seine eigene Taktik. Was mir aber wirklich alle Winterbader erzählt haben, ist, dass sie vor dem Hineingehen ihr „Gehirn ausschalten“ würden und, dass sie in diesen paar Minuten für sehr viele Stunden Energie tanken. Als plötzlich die Sonne durch den Milchglashimmel dringt, drehen wir synchron die Gesichter in ihre Richtung – sie wärmt noch immer.

Ein paar Tage zuvor erscheint ein Ostasiate in der Bucht. Nachdem er von mir hört, dass ich gerade im See war, zieht er sich spontan aus und geht auch hinein. Er behält dabei seine Unterhose an, bleibt für ungefähr zwei Minuten bis zur Brust eingetaucht stehen, kommt an Land, wo er an einer Baumwurzel Liegestütze macht. Dabei sagt er immer wieder: „Kalt. Kalt. Kalt.“ Das Ganze wiederholt er ein paar Mal, bis er sich schlussendlich mit seinem Unterhemd abtrocknet und wieder anzieht. (Ob er seine nasse Unterhose ausgezogen hat, habe ich nicht mitbekommen – Diskretion ist wichtig, gerade jetzt, wo sich keiner mehr hinter irgendeinem Blattwerk verstecken kann.)

Am Donnerstag genieße ich das für mich äußerst seltene Glück, gleich zweimal Kormoranen beim Tauchen zusehen zu dürfen.

Der Pandemia-Podcast mit einer sehr spannenden Folge über die Beulenpest-Pandemie von 1894/95, bei der erstmals Fotografien eine zentrale Rolle spielten – Zeitungen hatten erst kurz zuvor die technischen Möglichkeiten erlangt, diese zu abzudrucken. So war es möglich, dass das Bild von der Krankheit und ihren Opfern die kollektive Wahrnehmung bestimmte, da es den Schrecken und das Leid visuell verstärkte, ja, überhaupt erst so etwas wie das Gefühl für eine globale Krankheitssituation schuf. Dabei spielte auch die Maske als Symbol eine entscheidende Rolle. Die Ausführungen des interviewten Medizinanthropologen Christos Lynteris hochgradig interessant – einzig der Schlenker zur Covid-Pandemie fehlte mir. Hier hätten die Hosts gern über die Jerusalema-Dance-Challenge der Krankenschwestern und -pfleger oder die „Fotolegende der Bilder aus Bergamo“ sprechen dürfen. (Karl Lauterbach am 3. Mai 2020: „80% unseres Erfolgs waren die Horrorbilder aus Italien.“)

Ein wenig medizinhistorische Kenntnisse hätten auch Prof. Dr. Anika Klafki gutgetan, die als rechtswissenschaftliche Sachverständige in der Corona-Enquetekommission des Bundestags behauptete, dass im Mittelalter die sogenannten Pestschnäbel dazu beitrugen, die Seuche zu bekämpfen. Richtig ist, dass diese schnabelförmigen, mit Kräutern befüllten Masken erst im 17. Jahrhundert und da auch nur regional und sporadisch zum Einsatz kamen. Ihre Populärwerdung verdankten sie künstlerischen Darstellungen, die sie als Symbol für die Plage und den Pestarzt etablierten. Im Laufe der Zeit wurden sie dann als mittelalterlich umgedeutet, wodurch sie bis heute unser Bild vom „Schwarzen Tod“ prägen. Es wäre insgesamt außerordentlich hilfreich, wenn sich in den Corona-Enquetekommissionen und parlamentarischen Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und Landesebene die Beteiligten nur zu ihrem jeweiligen Fachgebiet äußern würden, ein an der einen oder anderen Stelle freundlicheres und ergebnisoffeneres Miteinander würde auch sehr helfen. Außer, man nimmt in Kauf, dass das schwindende Vertrauen in staatliche Institutionen und parlamentarische Vorgänge noch weiter sinkt.
„Sehet mich an: ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost funden. Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir.“