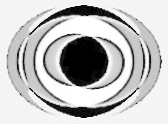Frank Schott, Leipzig
Dömitz hat für mich leider wenig zu bieten: Die Festung ist lediglich zwischen 10:30 und 15:30 Uhr zu besichtigen – nicht unbedingt tauglich für Radtouristen. Es gibt zwei Kirchen, von denen die 1999 geweihte, kleine katholische, bereits wieder entweiht ist. Ein Mann erzählt, dass das Gebäude in ein Kulturzentrum umgebaut werden soll. Nur noch die Buntglasfenster und die aufsteigende Decke erinnern an die frühere Nutzung. „Das war aber eine katholische Kirche?“, frage ich nach. Was er bestätigt. „Das ist ungewöhnlich“, merke ich an, „das ist doch hier klassisches Protestantenland.“ Er erklärt, dass viele Flüchtlinge Ende des Zweiten Weltkriegs ihren katholischen Glauben mithergebracht hätten – „inzwischen sind die aber alle verstorben, so dass es die Gemeinde nicht mehr gibt“.

Zu den wenigen Läden in Dömitz gehören eine Kunstwerkstatt, eine Galerie und ein Kreativtreff. Vielleicht ist es ja die Kultur, die den Ort am Leben hält, ihn für Touristen interessant macht. Ein Highlight hat diese kleine Stadt dann aber doch für mich parat: Dort wo die Elde in die Elbe mündet, sehe ich einen spektakulären Sonnenuntergang.

Nach einem kräftigenden Frühstück breche ich kurz nach 9 Uhr auf – die Festung leuchtet in der Morgensonne. Dann nimmt alles seinen üblichen Lauf: An einer Kreuzung ohne Wegweiser entscheide ich mich für den besser ausgebauten Weg – und lande natürlich wieder in einer Sackgasse. Korrekt wäre die andere Abzweigung gewesen. Der Weg ist das, was der gelernte Ossi eine Panzerfahrstrecke nennt – ein zweispuriger, mit gelochten Betonplatten befestigter Pfad. Nur fuhren hier seinerzeit keine Panzer, sondern DDR-Grenzpatrouillen.

Später tauchen auch gut erhaltene Wachtürme auf. Zur Sicherung ihrer Macht ließ die DDR-Führung Grenzanlagen errichten, schuf ein Klima der Angst, setzte auf Überwachung und Denunziation und bekämpfte gnadenlos jeden ihrer Kritiker. Ich wünschte, all jene Regierungen, die heute wieder dem Volk misstrauen und unliebsame Meinungen mit aller Härte durch die Staatsorgane verfolgen lassen, würden wenigstens ab und an in ein Geschichtsbuch schauen.

Erst auf dieser letzten Etappe gen Norden wird mir bewußt, dass ich der Kultur kaum Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ich erkundete zwar zu Fuß die jeweiligen Zielorte, machte aber keinen Schlenker zu Museen oder Denkmälern abseits der Route. Ich wollte einfach nur viele Kilometer schrubben, mir den Wind um die Nase pfeifen lassen, die bezaubernden Elblandschaften genießen – die blühenden Wiesen und Wälder, die üppig vollen Maisfelder, neben mir Schafe, Rinder und Pferde, am Himmel Schwalben, Spatzen und Adler …

… oder die Krähe, die über mir in der Luft steht, bevor sie abdreht und mit dem Luftstrom elegant davon schwebt. Wovon ich mich etwas veralbert fühle, denn auch heute komme ich im heftigen Gegenwind nur äußerst mühsam voran. Was mich aber nicht daran hindert, weiterhin meinen Blick schweifen zu lassen. 2025 können sich die hiesigen Obstbauern wohl nicht beklagen – ihre Bäume sind übervoll. Ich probiere einen der Äpfel. Der Geschmack ist mit dem der genormten aus dem Supermarkt nicht zu vergleichen: Bissfest, fein säuerlich, ein Genuss. Warum kommen die nicht in die Läden?

Ungefähr zwanzig Kilometer vor Boizenburg bläst mir der immer stärker werdende Wind regenschwere Wolken entgegen. Aber ich habe Glück und bekomme am Ende nur ein paar Tropfen ab.

Dann stellt sich die Frage, wo ich übernachten will – ich buche ein Zimmer in Geesthacht. Der empfohlene Radweg führt direkt durch Lauenburg, sonst wird man meist um die Orte herum geleitet. Die Altstadtstraße besteht aus historischem Kopfsteinpflaster. Das ist schick, romantisch – und dermaßen authentisch, dass ich schieben muss. Ich erreiche Geesthacht und habe 40 Minuten zu warten, bis die Rezeption geöffnet wird. Mein Zimmer gehört zu der Sorte, in der man den Abend am besten in Gesellschaft von zwei Dosen Bier verbringt. Zum Duschen und Schlafen reicht es. Seit Tagen schmerzt mein Hintern, aber ich sage ihm: „Reiß dich zusammen, du bist nicht der einzige Körperteil, der schmerzt.“ Doch in diesen Worten steckt auch Freude: Ich habe in sechs Tagen 672 Kilometer zurückgelegt – für den Rückweg kommen dann noch 300 Kilometer hinzu. Schon beeindruckend, was man leisten kann- wenn man es versucht.