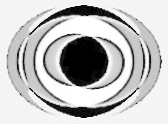Walter Kintzel, Parchim
In der Not besinnt sich der Mensch auf die Natur

In Kriegszeiten, Nachkriegszeiten und in anderen Notzeiten, greift der Mensch verstärkt auch auf die Naturprodukte zurück, die er vorher nicht beachtet oder gar geschmäht hatte. Exemplarisch soll dieses anhand der Rotbuche und Saatkrähe dargestellt werden.
Im Mittelalter wurde die Rotbuche ein „bärend bom“ genannt, das bedeutet, ein gebärender, also fruchttragender Baum. Dass Bucheln (Bucheckern) in der Waldmast als Schweinefutter genutzt wurden, ist uns geläufig – in manchen Gegenden Deutschlands überlebte im Volksmund das Sprichwort: „Eine blinde Sau frisst keine taube Buchel.“
Neben der Nutzung in der Tierhaltung können die Früchte auch für die menschliche Ernährung verwendet werden. Beim Verzehren größerer Mengen müssen diese vorher mit kochendem Wasser abgebrüht werden, weil sie u.a. Blausäure-Glykoside enthalten, die beim Zerkleinern, Kauen oder Verdauen giftige Blausäure (Cyanid) freisetzen können. Das aus Bucheckern gewonnene Öl, das nach dem Zweiten Weltkrieg zu Margarine verarbeitet wurde, war jedoch völlig unbedenklich und ein mildes, haltbares Speiseöl. Aus alten Aufzeichnungen ist ersichtlich, dass sich aus einem Zentner der Früchte „zwölf Pfund reines, zu Speisen gutes, und vier Pfund trübes Öl zum Brennen in den Ampeln“ pressen ließ.
In den Jahren des Ersten Weltkriegs und der Nachfolgezeit erlangte Buchenöl eine große wirtschaftliche Bedeutung. 1916 verbot aus diesem Grund der damalige Bundesrat, Bucheckern zu verfüttern; die gesammelten Früchte mussten direkt an den Kriegsausschuß für Fette und Öle geliefert werden.
In der „Verordnung des Kriegsernährungsamtes“ vom 13. Juli 1918 und der „Mecklenburgischen Ausführungsverordnung“ vom 30. August 1918 wurde dieses bekräftigt: „Weil die Ölgewinnung am meisten not tut“, durften die Bucheckern nur zu diesem Zwecke herangezogen werden, eine anderweitige Verwendung war nur im absoluten Ausnahmefalle gestattet.
In einem Aufruf des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin vom 13. September 1918 heißt es: „Wie im ganzen deutschen Vaterlande, so hängen auch unsere Buchenwaldungen in Mecklenburg-Schwerin voller Buchenmast. Seit Menschengedenken hat der Buchwald nicht so zahlreiche Früchte getragen, wie er uns in diesem Herbste bescheren wird, und wohl niemals hat die gesamte Bevölkerung der unscheinbaren Frucht der Buche so sehr ihre Aufmerksamkeit gewidmet, wie in diesem Kriegsjahre. Die reiche Ernte muß so vollständig wie möglich geworben werden. Gelingt dies, dann wird uns aber in diesem Segen der Natur eine ungeahnt große Hilfsquelle erschlossen, sowohl für die Volks- wie für die Viehernährung, und auch der Buchenwald wird sein Teil dazu beitragen, den Wirtschaftskrieg siegreich zu bestehen.“

Mit den folgenden Hinweisen waren einzelne Abschnitte des Aufrufs
überschrieben:
Wo darf gesammelt werden?
Wann muß gesammelt werden?
Wie muß gesammelt werden?
Freigegeben für jedermann war die Sammlung in allen Waldungen, die unter landesherrlicher Verwaltung standen; an städtische und private Besitzer war der Aufforderung ergangen, ihre Buchenwälder auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, wobei „unbedingt hinsichtlich des Betretens der großherzoglichen Forsten die von den
Forstbehörden erlassenen Anordnungen zu befolgen sind“.
Zur Art und Weise des Sammelns hieß es u.a.: „Die einfachste Art des Sammelns wird das Auflesen mit den Händen sein. Es wird dies auch wohl die am meisten zur Frage kommende Art und Weise der Werbung bleiben, zumal sich jedermann, auch kleine Kinder daran beteiligen können. Auf diese Weise ist es auch am einfachsten, die tauben Bucheckern gleich auszuscheiden, da der geübte Blick diese bald erkennen wird.“ Man empfiehlt aber auch andere Methoden, z.B. beim Abschütteln der Zweige einen umgekehrten Regenschirm zum Auffangen der Früchte zu benutzen.
In allen größeren Orten waren Annahmestellen errichtet worden, die ebenfalls mitgeteilt wurden. Der Höchstpreis war mit 1,50 M für ein Kilogramm lufttrockener Bucheckern angegeben. Der Sammler bekam bei der Ablieferung einen Ölbezugschein oder Schlagschein. Auf Grund des Ölbezugscheines konnte er 6% des Gewichtes der abgelieferten Buchecken in Öl beziehen. „Gegen Ausstellung des Schlagscheines hat der private Sammler das Recht, eine gleiche Menge Bucheckern, wie er abgeliefert hat, für sich zu Öl schlagen zu lassen und er hat zu gleicher Zeit einen Anspruch auf den hierbei gewonnenen Ölkuchen“.
Es folgte der Hinweis, dass Bucheckern im zerkleinerten Zustand zwar an Schweine, Wiederkäuer und an das Federvieh verfüttert werden können, jedoch nicht an Pferde und sonstige Einhufer, weil die Früchte für letztere giftig seien, was auch für die Ölkuchen gilt.

Nun zur tierischen Nahrung. In der Norddeutschen Post aus Parchim findet sich im Mai 1916 dieses: „Bei der gegenwärtigen Lage des Fleischmarktes ist es geboten, ihm auch sonst weniger beachtete Nahrungsmittel zuzuführen. Zu diesen gehören die durchaus wohlschmeckenden jungen Saatkrähen.“
Weiter wird ausgeführt, dass die rabenartigen Vögel Rabenkrähe, Nebelkrähe, Saatkrähe, Elster und Eichelhäher Gegenstand des freien Tierfanges sind: „Es empfiehlt sich aber, die Saatkrähen in diesem Jahr darüber hinaus planmäßig der Volksernährung nutzbar zu machen.“ Der Abschuss der Vögel kann durch den Eigentümer des Gehölzes, in dem sich die Krähenkolonie befindet, erfolgen oder ist durch andere „zuverlässige Personen zu gestatten“. Für den Fall, dass Schützen fehlen oder die Preise für die Munition zu hoch seien, empfahl man das Erklettern der Bäume, auf denen sich die Nester befinden. Die noch nicht flüggen Krähen sollten herabgescheucht werden. Näheres wurde vom Ministerium für Landwirtschaft in der „Verfügung über die Nutzbarmachung von Saatkrähen für die Volksernährung“ festgelegt.
Und dieses war in den Jahren der Hungersnot ebenso geregelt: „Sowohl bei der behördlichen wie bei der geschlossenen Sammlung genießen die Schulen, wenn sie zum Sammelorte die Eisenbahn benutzen wollen, den Vorzug, daß sie auf Fahrscheinen zum halben Preis der 3. Wagenklasse befördert werden.“
Ich weiß zum großen Teil noch aus eigenem Erleben, dass es ohne die Kinder in solchen Situationen nicht geht. Mir seien deshalb an dieser Stelle einige persönliche ergänzende Angaben gestattet.
Im Winter 1946/47 hatten wir Temperaturen bis zu minus 25 Grad und Dauerfrost über 40 Tage. Die Kälte war noch grimmiger als in den Vorjahren und dauerte lange an. Man sprach damals von einem „Jahrhundertwinter“ (tatsächlich war jener Winter der viertkälteste im Zeitraum von 1881 bis heute). Eine Folge dessen war, dass die eingemieteten Kartoffeln erfroren und verdarben. Wärend dieses Winters starben allein in Deutschland über 500.000 Menschen an den Folgen von Hunger, Kälte und Mangelkrankheiten.

Sobald das erste Grün erschien, wurden von uns allen Brennnesseln und Melde gesammelt und das dann zu einer Art Spinat verarbeitet – nur in Wasser gekocht, ohne Fett oder gar einem Ei. Wochenlang ging das so, ich habe noch Jahrzehnte danach keinen Spinat mehr essen können. Aus Haferstroh wurde Tee gemacht und aus den Maitrieben der Gemeinen Kiefer Sirup, ein Brotaufstrich, der von uns Kindern, sicherlich auch auf Grund des aromatischen Geschmacks, gern gegessen wurde.
Ein weiteres großes Problem in den Kriegs- und Nachkriegsjahren war die Versorgung mit Trinkwasser. Von den Bewohnern unserer Straße wurden Regentonnen, Eimer und Badewannen mit Schnee befüllt, und wenn es taute, das ablaufende Wasser von den Haus- und Schuppenwänden aufgefangen. Die Tropfen vom Dach nahmen wir mit Lappen auf und verwendeten diese zur Körperreinigung. Einige Familien holten ihr Wasser aus dem Fluss, was man selbst im Malzkaffee noch herausschmeckte.
Diese Zeiten liegen gar nicht so lange zurück.
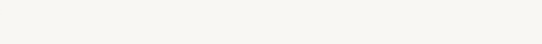
Die zugrundeliegende sowie weiterführende Literatur und andere Quellen können gern beim Autor angefragt werden. (botaniktrommel@posteo.de)