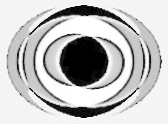Frank Schott, Leipzig
Großes Thema in der Familie und im Ort ist das neue Logo der Stadt Leipzig. Die Kommune wollte sich ein modernes Corporate Design geben und dazu auch das Logo anpassen lassen. Über 700.000 Euro sollen in die Renovierung geflossen sein. Das Ergebnis, ein fraktales Strichmännchen, das aussieht wie ein Boxer mit Kopfschutz und Schwanz, gefällt niemandem. Es gibt bereits eine Petition, welche die Rückkehr zum alten Logo fordert.
Als Werbemensch kann ich den Antrieb des Stadtmarketings verstehen – blau und gelb sind wirklich nicht unbedingt moderne und ansprechende Farben. Sie lassen beim Gestalten von Websites und Flyern nicht viel Spielraum. Den detailreichen Löwen, der seit dem 15. Jahrhundert das Wappen prägt, vereinfachen zu wollen, kann ich auch verstehen. Bei Logos gilt schließlich der Grundsatz – man muss es auch verkleinern können, ohne dass es verschmiert oder unkenntlich wird (z.B. für Visitenkarten oder Social Media).

Das jetzige Ergebnis lässt sich meiner Erfahrung nach am besten damit erklären, dass eine große Arbeitsgruppe auf Seiten der Stadt involviert war. Und jeder wollte etwas Anderes – der Bürgermeister möglicherweise das hässliche Gelb loswerden, der Marketingchef die blauen Linien behalten. Der Gleichstellungsbeauftragte forderte vielleicht barrierefreie dicke Linien, der Tierschutz die Entfernung des Löwen, denn schließlich seien Raubtierdressuren ja auch im Zirkus längst verboten. Was macht man als Agentur in so einem Fall? Man verwässert einen Entwurf solange, bis alle Parteien unzufrieden sind. Wenn jeder meckert, hat keiner gewonnen – übrig bleibt ein Löwe, der aussieht, als wäre er aus Büroklammern gebogen.

Hässlichkeit ist ein Merkmal unserer Zeit, darum jetzt zu etwas Schönem: Das Ergebnis eines Lächelns ist ein Lächeln. Ein kurzes grüßendes Kopfnicken, ein mit einem Lächeln angedeutetes „Guten Morgen“ oder die unter Läufern als Geste des Respekts erhobenen zwei Finger der linken Hand – all das zaubert auf mürrische graue Gesichter ein farbiges Lächeln. Und das ist das Beste, was einem an einem kalten trüben Novembertag passieren kann.

Nachdem ich jüngst mit fehlender Motivation, kraftlosen Beinen und mangelnder Ausdauer zu kämpfen hatte, entscheide ich mich gegen meine Standardstrecke. Es ist kalt, nur knapp über null Grad. Ich fahre mit dem Rad die zwei Kilometer bis zum Auenwald und starte dort meinen Lauf. Vielleicht ist es tatsächlich die andere Umgebung (gänzlich neu ist sie mir natürlich auch nicht), die mich beflügelt – am Ende werden es 13,3 Kilometer, ohne dass es mich erschöpft.

Auf dem Elsterflutbett sind die Einerkanuten unterwegs, die meisten haben Handschuhe an, so wie ich auch. Ein paar Radfahrer kreuzen meinen Weg, einige Menschen mit Hund, Familien mit Baby im Kinderwagen oder am Tragebeutel vor der Brust. Eine Meise hüpft über dürre Zweige, eine Maus oder ein ähnlich kleiner Nager raschelt im Laub. Eine Motorsäge knurrt – jetzt wo alles verblüht ist, wird wieder Feuerholz aus dem Wald geholt.

Nunmehr sind es bei uns fast fünf Tage ohne Regen, davon drei vergleichsweise warme. Das hat die Waldwege merklich trockner werden lassen. Die noch feuchten und rutschigen Stellen sind mit einer dicken Schicht Laub bedeckt, so dass man nicht mehr ins Schlittern gerät. Auf den Bächen und Flussläufen im Auenwald liegt regungslos ein Laubteppich, der das das Auge narrt, in dem er einen begehbaren Weg vorgaukelt. Manchmal wirft ein Windstoß gelbrote Blätter von den Bäumen, die dann wie übergroße Schneeflocken sacht zu Boden schweben. Es läuft sich vielversprechend, meine Zeit pro Kilometer liegt endlich wieder deutlich unter sechs Minuten. Ich renne bis zum Nordufer des Cospudener Sees, folge dem See eine Weile und kehre dann über eine alternative Route zurück. Kurz liebäugele ich mit einem Halbmarathon, will es dann aber nicht übertreiben. Der Körper sagt mir nach dem etwa 75-minütigen Lauf, dass es ihm gut geht, es für heute jedoch reicht. Es kommen noch andere Tage und andere Läufe.