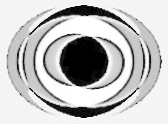Helko Reschitzki, Moabit

Grauer Sonntagmorgen mit einer Feuchtigkeit, die in die Knochen kriecht – das Aufmachen zum Schlachtensee kostet Überwindung, obwohl es mit 10 Grad nicht einmal kalt ist. Um acht ist die S-Bahn fast leer – die Schattenkolonne der migrantischen Niedriglöhner ist lang schon auf Arbeit, die Kirchgänger und Radausflügler sind noch zuhause. In der Bucht ist es etwas angenehmer, aber windig. Die Wassertemperatur beträgt 14°C, wie mir einer der beiden jungen Angler erzählt, die ich dort kennenlerne. Sie haben ein Zelt und ein Schlauchboot dabei, wollen das gesamte Wochenende campen. Sie gehen auf Hechte, Aale, Karpfen, ihr Liebling ist jedoch der Zander – „Eine Delikatesse! Kennen Sie den?“ „Kenn ich! Aber lang schon nicht mehr gegessen.“ Rotfedern nehmen sie maximal als Köder. Wie alle, die man im Spätsommer und Herbst am Ufer trifft, lobpreisen sie das Filtersystem des Sees – dadurch ist das Wasser das gesamte Jahr über sauber. Ob ein See zum Angeln besser klar oder trüb ist, hängt von der Fischart ab. Im Winter machen sie Pause, weil die Fische ruhen, und in allzu heißen Sommer, weil die Fische zu träge sind. Sie freuen sich über den momentanen Wind, da die Wellen ihre Köder bewegen. Da ihnen die „Fischerhütte“ inzwischen zu teuer ist, haben sie Proviant mitgebracht. Wir unterhalten uns über die Farben im Büchsenlicht, die Sonnenaufgänge, den Nebel. Ich freue mich, dass mal jemand, ganz beiläufig, das Wort „Büchsenlicht“ benutzt.

Am Montag treffe ich zufällig das tiefenentspannte Pärchen, dem ich so ungefähr einmal im Monat am See über den Weg laufe. Beide sind Anfang/Mitte 60 und äußerst freundlich im Umgang miteinander -und auch zu mir. Der Mann hat sich gerade einen Arm gebrochen und geht deshalb nur bis zu den Knien ins Wasser. Seine Frau macht „aus Solidarität“ mit, flüstert mir aber zu, dass sie sich das wohl nochmal überlegen werde. Wir kommen aufs Winterschwimmen zu sprechen. Er ist sogar Eisbader, sagt, das Gefährlichste daran sei der Weg zum Loch. Sollte der See diesen Winter wieder zufrieren, wollen sie sich Schuhspikes kaufen. Er ist von meiner regenfesten Sitzmatte auf der feuchten Bank angetan – zumal sie im Rucksack normalerweise als Rückenstütze und Buchschutz dient, wie ich ihm zeige. Es sind oft Kleinigkeiten, die das Leben einfacher machen.

Dienstagmorgen Berlin mit Waschküchenanmutung, nur kühler – der Funkturm ist aus 50 Metern nicht einmal zu erahnen. Unfeierliche Einweihung des am Vortag gekauften See-Thermometers: immer noch 14 Grad Celsius Wassertemperatur – das ist gut auszuhalten. Während ich auf dem Rückweg auf die S-Bahn warte, schaue ich einem Atomatenbefüller bei der Arbeit zu – da sitzt jeder Handgriff.

Am Abend erreicht mich die Nachricht, dass Franz Josef Wagner tot ist. Den ersten Satz, den ich von ihm las, war 1991 die Schlagzeile in der von Burda schnell auf den Markt geworfenen Wendezeitpostille Super!: „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen – ganz Bernau ist glücklich, daß er tot ist“. Mit mir lachte der halbe Osten – auch wenn die Story nur erfunden war. Später kam mir ab und an seine Kolumne „Post von Wagner“ unter, die hervorragend geschrieben und immer aufregend war, im Guten wie im Schlechten. Er hatte das, was jeder Autor und jede Autorin sucht: einen unverwechselbaren Sound. Vor fünfzehn Jahren lag sein Lebensbericht „Brief an Deutschland“ in den Läden. Der Ausschnitt auf dem Umschlag nervte mich – irgendetwas mit Gestapo und Stasi. Trotzdem nahm ich das Buch zur Hand, blätterte darin, las mich fest. Wollte es blöd finden, der Mann war schließlich bei der BILD und hatte ein paar wirklich üble Sachen rausgehauen. Blätterte nach ein paar Wochen wieder darin, wurde in den Text gezogen, kaufte es. War beim Lesen erschüttert, las es seitdem ein paar Mal – meist möchte ich nur eine Stelle nachschlagen und kann dann nicht aufhören. Sehe in FJW auch meinen Vater – beides Flüchtlingskinder, die an der Hand ihrer Mütter vor den Sowjetsoldaten flohen, der eine aus Olmütz, der andere aus Canditten. Konnten das beide nie vergessen, wurden dadurch zu dem, wer sie sind. Franz Josef Wagner über die zwei Jahre im Flüchtlingslager: „Angst breitet sich aus wie Grippe. Am schwersten können Kinder mit dem Ungewissen leben. Wenn Kinder weinen, erzählt man ihnen von morgen, so lenkt man sie vom Weinen ab. Was morgen sein wird, wussten die Erwachsenen nicht. Das spürt ein Kind und es kriegt mehr Angst. Kätzchen sagte meine Mutter zu den Ratten im Lager. ‚Es sind Kätzchen.’“ Schriftsteller wurde Franz Josef, gleich nachdem er lesen und schreiben konnte: Da er es nicht ertrug, dass Winnetous Schwester starb, übertünchte er die entsprechenden Buchseiten und schrieb darauf kurzerhand Karl May um – bei ihm heiraten Nscho-tschi und Old Shatterhand. Was er in „Brief an Deutschland“ über die DDR sagt, deckt sich exakt mit dem, was ich damals, Ende der Achtziger, empfand – und das ausgerechnet von einem Wessi! Er, der Heimatvertriebene, spürte wohl, dass uns im Osten so langsam die Heimat abhanden kam. 2023 überredete der Kriegsreporter und Podcaster Paul Ronzheimer seinen Kollegen, bei ein paar Flaschen Wein einfach aus seinem Leben zu erzählen. Über die Kriegs- und Nachkriegszeit, den Werdegang als Journalist, die Reportagen aus dem Vietnam- und Jom-Kippur-Krieg, die Begegnungen mit Muhammad Ali, Romy Schneider, Marlene Dietrich, Beckenbauer, Hannelore Kohl, Boris Becker, die Kneipenfreundschaft zum späteren Terroristen Andreas Baader … Von jeder der Geschichten würde ich gern viel, viel mehr Details erfahren – nicht, weil ich Indiskretes mag, sondern weil Franz Josef Wagner so packend Geschichten erzählen konnte. Nun ist er verstummt und kann auch nicht mehr das Buch schreiben, von dem er noch träumte – ein Buch über die tödlichen und schönen Winde.

Am Mittwoch neun Stockenten, zwei Blässhühner, drei Schwäne und eine Wespe in der Bucht – die Enten und Rallen auch am Donnerstag und Freitag. In der Bahn inzwischen genau so viele Leute mit Nasen-Mund-Schutz wie Palästinensertuchträger – das RKI verzeichnet für die vergangene Woche rund 7,5 Millionen Atemwegserkrankungen in Deutschland. Nicht einer trägt die Maske richtig – ganz abgesehen davon, dass sie sowieso nichts nützen (wie man u.a. in den RKI-Protokollen nachlesen kann). Hauptverursacher für die aktuellen Infekte sind Rhinoviren. Die COVID-19-Inzidenz liegt laut GrippeWeb des RKI auf dem „niedrigen Niveau“ von rund 400 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern. Als im März 2020 erste Maßnahmen gegen COVID‑19 ergriffen wurden, lag die 7‑Tage‑Inzidenz in der BRD bei etwa 5; Weihnachten erreichte sie mit 197 den Höchstwert für 2020.

Gute Nachrichten: Der von mir seit Jahrzehnten sehr geschätzte Bernd Siggelkow, Gründer des Kinderhilfswerks „Die Arche“, hat angekündigt, bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Meine Stimme hätte er, egal, für welche Partei er antritt. (leider nicht mein Wahlkreis). Kaum jemand hat sich hierzulande so engagiert für die Speisung armer Kinder und deren Bildungschancen eingesetzt wie Pfarrer Siggelkow – wer wissen möchte, wie es wirklich um unser Land bestellt ist, sollte ihm gut zuhören. Genau wie man dem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler Thomas Krüger zuhören sollte, der nach fünfundzwanzig Jahren als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung in den Ruhestand gegangen ist, und gerade ein paar Abschiedsinterviews gibt. Er hat aus der BPB eine gesamtdeutsche Institution gemacht, die (trotz des blöden Namens) immer einen Besuch lohnt – allein für die Schriftenreihe!

Am Freitag treffe ich das alte Pärchen wieder, mit dem ich schon so manches schöne Buchtgespräch hatte. Sie haben ihre Badesaison nun beendet, freuen sich aber, dass ich noch ins Wasser gehe. Als ich ihnen mein Thermometer zeige, müssen sie anerkennend lachen. Der Mann erzählt mir, wie die Bucht vor fünfzig Jahren aussah – da gab es dort noch eine kleine Insel, die sich im Laufe der Zeit mit dem Ufer verband. Perspektivisch werde die Bucht verschwinden, weil die Schilfgürtel von beiden Seiten aufeinander zuwachsen. Der circa Neunzigjährige macht einen Vorschlag, wie man das verhindern könnte – irgendwann im Sommer sagte er mir, dass man in manchen Situationen partisanisch handeln müsse. Ich mag die beiden sehr.

Passend zum Nebel beobachtete ich dieser Tage immer mal wieder fasziniert ein paar der gleichnamigen Krähen. Die haben den berliner Fahrzeugverkehr mit all seinen Tücken definitiv besser kapiert als die meisten PKW-, LKW-, Kleinbus-, Fahrrad-, Lastenrad-, E-Bike-, E-Rollerfahrer und Fußgänger. Im Jahr 1864 prägte der englische Philosoph und Soziologe Herbert Spencer den Begriff „survival of the fittest“ – eine Aussage, die heute wohl mehr denn je gilt.